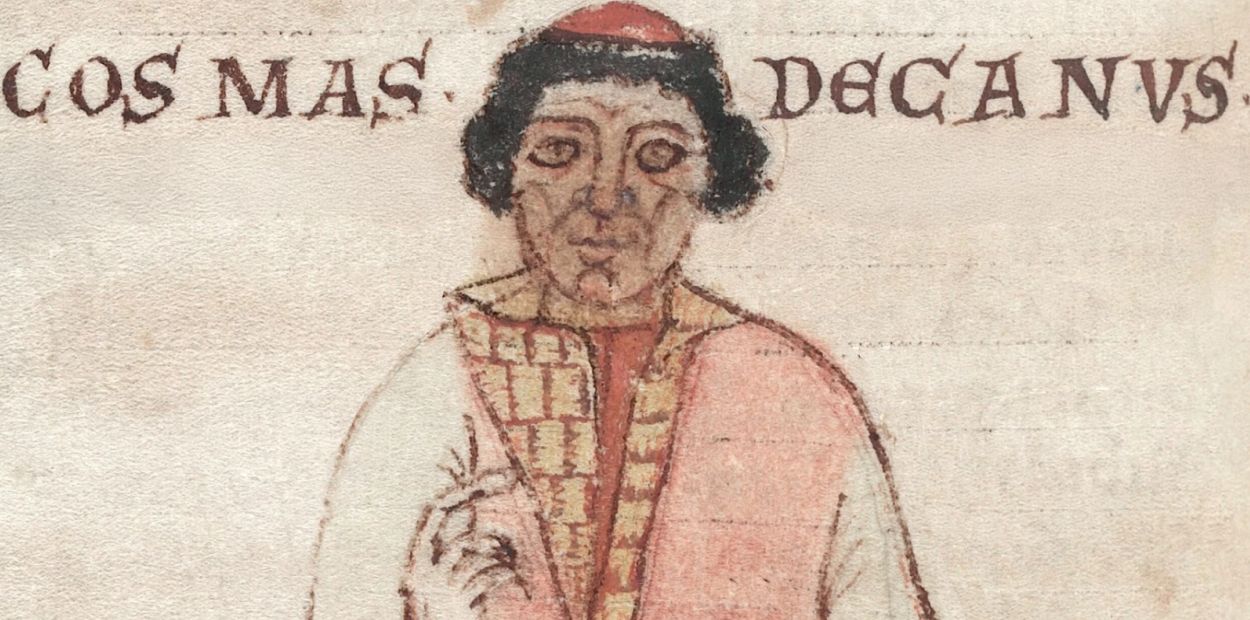Er überlebte den Holocaust, stellte sich gegen das kommunistische Regime und prägte mit seinen Romanen die tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts: Der Schriftsteller, Dramatiker und Dissident Ivan Klíma ist vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren in Prag gestorben.
Klíma, einer der bedeutendsten tschechischen Autoren der Nachkriegszeit, starb am vergangenen Samstag, den 4. Oktober 2025, nach langer Krankheit in seinem Zuhause in Prag. Geboren wurde er am 14. September 1931 als Ivan Kauders. Drei Jahre seiner Kindheit verbrachte er gemeinsam mit seiner Familie aufgrund ihrer jüdischen Abstammung im Konzentrationslager Theresienstadt. Nach der Befreiung wurde er zu einer der prägenden Stimmen einer Generation, die zwischen totalitären Systemen, persönlicher Verantwortung und moralischer Integrität aufwuchs. Seine Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, erschienen aber hauptsächlich auf Deutsch.
Vom gefeierten Dramatiker zum verbotenen Autor
In den 1950er Jahren schienen viele Intellektuelle der jungen Tschechoslowakei in der Ideologie des Sozialismus einen Neubeginn zu sehen. Auch Klíma trat 1953 in die Kommunistische Partei ein und wurde schnell zu einem aufstrebenden Autor. Mit seinem Stück Ein Schloss wurde der Schriftsteller als „Erneuerer des tschechischen Dramas“ gefeiert, bevor er sich gegen die ideologische Verhärtung seiner Partei wandte. In einer öffentlichen Rede auf dem Schriftstellerkongress im Jahr 1967 bezichtigte er das Regime des Machtmissbrauchs, woraufhin er aus der Partei ausgeschlossen wurde.
Nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen 1968 verließ Klíma die Tschechoslowakei und nahm einen Lehrauftrag an der Universität Michigan in den USA an. Drei Jahre später kehrte er zurück, doch seine Werke durften bis zur Samtenen Revolution 1989 wegen eines in der Tschechoslowakei geltenden Publikationsverbots nur im Ausland erscheinen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er vor allem als Vermesser und Drehbuchautor – auch für die beliebte tschechische Zeichentrickserie „Der kleine Maulwurf“.
Literarisches Gewissen einer Generation
Klíma blieb trotz Zensur und Überwachung ein scharfer Beobachter seiner Zeit. Sein wohl bekanntester Roman Richter in eigener Sache (1978) untersucht die moralische Hilflosigkeit des Einzelnen im totalitären Staat. Später widmete er sich der Reflexion über Schuld, Verantwortung und persönliche Irrtümer – Themen, die in seiner Autobiografie Moje šílené století (Mein verrücktes Jahrhundert, 2009–2010) ihren Höhepunkt fanden.
Mit seinen Werken prägte Klíma das tschechische kulturelle Gedächtnis nach dem 20. Jahrhundert. Er stand in einer Reihe mit Autoren wie Milan Kundera, Bohumil Hrabal und Ludvík Vaculík, die das Verhältnis zwischen Individuum und Macht neu definierten. Trotz der Schrecken seiner Jugend blieb Klíma versöhnlich. Als er 2002 den Franz-Kafka-Preis erhielt, sagte er über Deutschland: „Dass die SS Deutsch sprach, kann man der Sprache nicht anlasten.“