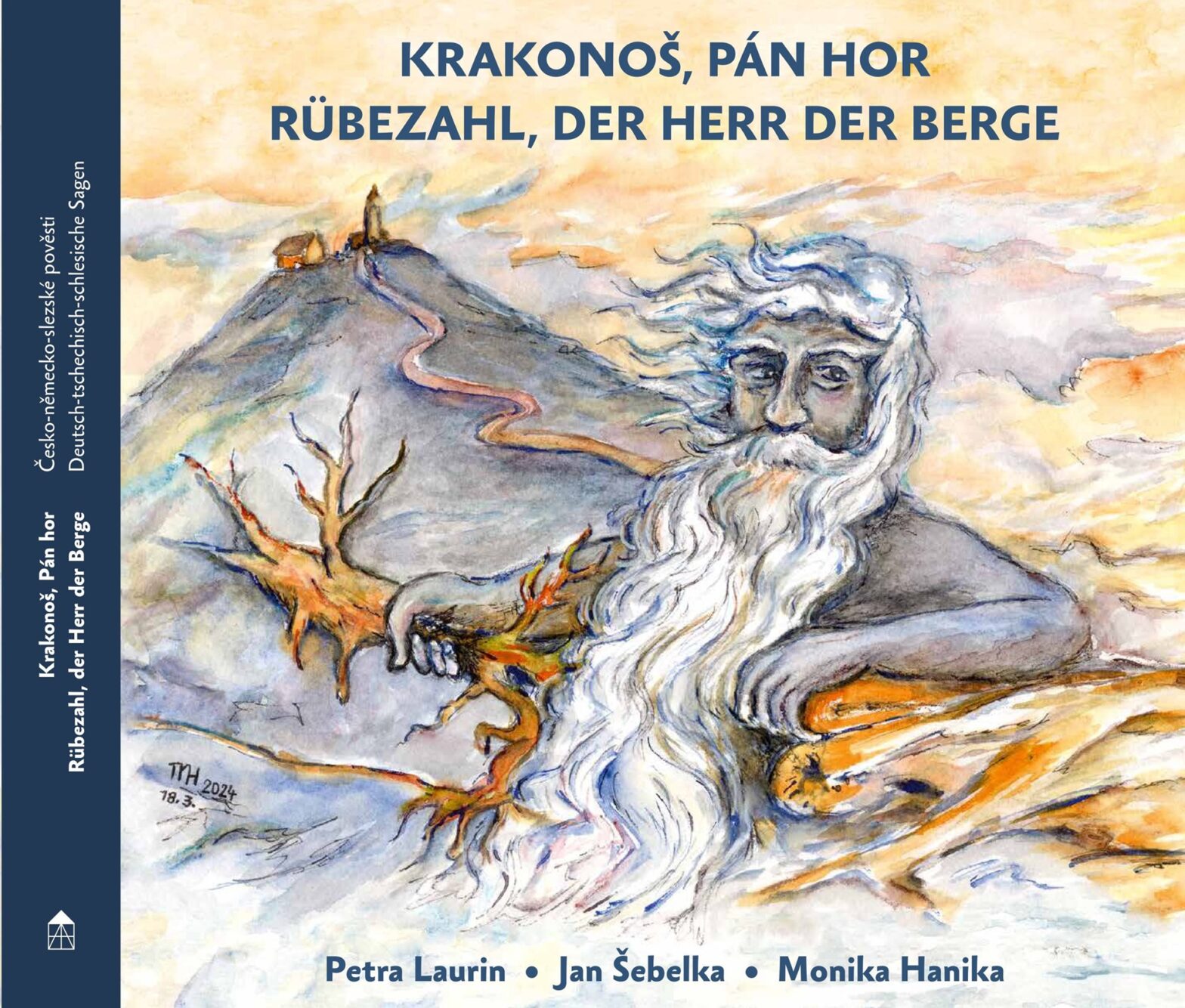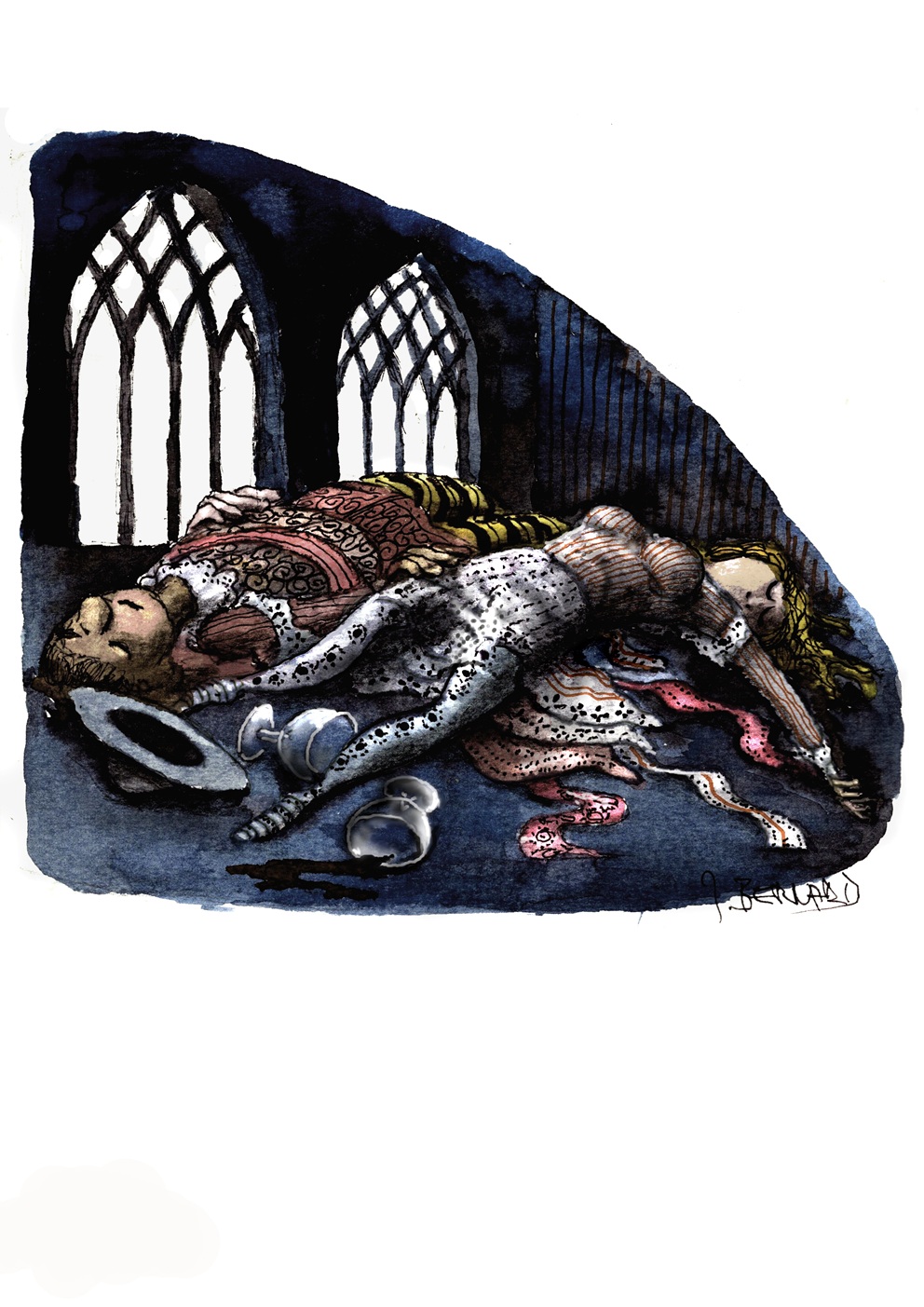Am kommenden Samstag, den 31.05., findet der Brünner Versöhnungsmarsch in seiner jetzigen Form bereits zum zehnten Mal in Folge statt. Vor dem Jubiläum haben wir mit Jaroslav Ostrčilík gesprochen, der den Versöhnungsmarsch einst initiierte.
LE: Wie war Ihr Werdegang: Familie, Studium, Interessen, Jobs?
Ich komme aus Südmähren, aus einem Dorf unweit von Pohrlitz [tsch. Pohořelice]. Ab der Wende bin ich aber in Niederösterreich an der Grenze zu Tschechien aufgewachsen. Dort hatten einige meiner Mitschüler Großeltern oder andere nahe Verwandte, die aus Südmähren vertrieben wurden. In den Neunzigern, als die tschechische Gesellschaft noch nicht bereit war, sich dem Thema zu stellen, wusste ich also bereits, dass da vor Jahrzehnten etwas Schlimmes passiert war. Nach der Matura – auf Deutsch: „Abitur“ – bin ich zurück nach Brünn [tsch. Brno] gezogen, wo ich unter anderem Germanistik studiert und vom Brünner Todesmarsch erfahren habe.
LE: Wann und woher kam die Idee zu dem Erinnerungsmarsch von Alt-Brünn nach Pohrlitz? Was war die Motivation: Erinnerung, Mahnung, Geschichtslücken, Gegenwart, Zukunft?
Ich hatte mich damit nicht abfinden können, dass innerhalb von Monaten ein wesentlicher Teil der Bevölkerung Brünns verschwand. Nachdem unmittelbar davor auch noch mehr als zehntausend Brünner dem Holocaust zum Opfer gefallen waren, ging ein großer Teil der Identität der Stadt verloren. Davon hatten die allermeisten Brünner damals, vor fünfzehn oder zwanzig Jahren, kaum eine Ahnung. Geschweige denn, dass sie wüssten, wie die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung vonstattenging. Oder wie sich das Zusammenleben beider Sprachgruppen, später Nationalitäten, über Jahrhunderte gestaltet hatte. Daher hatte ich überlegt, wie man den Todesmarsch, der ja im gewissen Sinne einen Höhepunkt bestimmter Entwicklungen darstellte, wieder ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit bringen könnte. Der Ausgangspunkt war, dass es wenig effektiv wäre, auf einer abstrakten Ebene zu bleiben und über Opferzahlen zu sprechen. Für die meisten Menschen ist Geschichte viel einfacher erfassbar, wenn sie personalisiert wird – denken wir zum Beispiel an Anne Frank. Oder wenn sie – wie im Falle des Versöhnungsmarschs – erfahrbar gemacht wird. Außerdem war dieses Format, nämlich dass man die 32 Kilometer selber marschiert, für die Medien attraktiv. Erstens bot das eine starke Story: Studenten gehen da den ganzen Tag irgendwo hin – Warum tun sie das? Und zweitens lieferte das Format gute Bilder. Das Medieninteresse war sehr wichtig, wenn die Öffentlichkeit von dieser Initiative, und damit von den historischen Ereignissen, nicht nur in Bezug auf den Todesmarsch nach Pohrlitz, erfahren sollte. Das war das vorrangige Ziel. Ich hatte mir damals gewünscht, dass dieses Projekt zur Auseinandersetzung mit der Vertreibung allgemein beiträgt, über Brünn hinaus. Und wer weiß, vielleicht würden sich auch Landsleute in Deutschland und Österreich von der Initiative angesprochen fühlen? Dass das alles tatsächlich gelingen würde, und noch dazu in so einem Maße, das hätte ich damals nicht gedacht.

Als Student am Germanistikinstitut der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn hat Jaroslav Ostrčilík (41) nicht nur den Versöhnungsmarsch und mit der Veranstaltung zusammenhängende Projekte, sondern auch die „Drehbühne Brno“ mitbegründet – im Rahmen des studentischen Theaterfestivals in deutscher Sprache begegnen einander bis heute Studierende aus ganz Europa. Ostrčilík hat sich darüber hinaus in einer ganzen Reihe weiterer zivilgesellschaftlicher Projekte und in der Kommunalpolitik engagiert und war zwischenzeitlich als freier Journalist tätig. Derzeit arbeitet er in der PR-Branche. 2018 wurde Jaroslav Ostrčilík als Initiator des Marsches der Versöhnung in Berlin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Nach langem Aufenthalt in Prag lebt Jaroslav Ostrčilík wieder in Brünn, wo er sich beim Deutschen Kulturverein Region Brünn engagiert.
LE: Wie war das Echo auf den ersten Marsch?
Zunächst sehr bescheiden. Ich hatte schon damals, Mitte der Nullerjahre, Kontakt zu den Brünner Deutschen, also Hanna Zakhari [ehem. Vorsitzende des Deutschen Kulturvereins Region Brünn, Anm. d. Red.] und vielen anderen. Die hatten sich einerseits sehr gefreut, dass ein junger Mensch an ihr Schicksal erinnerte, aber einige hatten auch Angst. Nach den Jahrzehnten des Kommunismus, wo sie als „national unverlässlich“ diskriminiert worden waren und zum Beispiel nicht hatten studieren dürfen, wollten sie nicht allzu sehr auf sich aufmerksam machen. Die ersten acht Jahrgänge des Marsches hatten allerdings keine allzu große Reaktion seitens der Mehrheitsgesellschaft hervorgerufen. Es sind Zeitungsartikel über die Initiative erschienen, sowie Beiträge im Radio oder Fernsehen. Aber die Politik, sowie Gegner der Aufarbeitung und Versöhnung, haben das Projekt mehr oder weniger erst 2015 entdeckt. Abgesehen natürlich vom damaligen Stadtrat, der den wahrhaft historischen Versöhnungsmarsch 2015 überhaupt erst ermöglicht hatte.
LE: Wann hat sich Ihre Mitstreiterin, Autorin Kateřina Tučková, der Initiative angeschlossen?
Im Jahr 2007 hatte sich Kateřina eine Woche nach dem ersten Gedenkmarsch auf den Weg nach Pohrlitz gemacht, um, unabhängig von meiner Initiative, Erfahrungen für ihren Roman zu sammeln. Das nächste Mal sollten sich unsere Wege erst 2015 kreuzen. Ihr Buch „Vyhnání Gerty Schnirch“, welches in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Gerta, das deutsche Mädchen“ erschienen ist, hat zum Bewusstsein um den Todesmarsch von Brünn beigetragen, und zu einer breiteren Diskussion über die Vertreibung. Mindestens genauso viel wie der Versöhnungsmarsch. Wenn nicht sogar mehr. Deswegen haben wir Kateřina 2015 mit ins Boot geholt, sozusagen als Gesicht des „Jahres der Versöhnung“, im Rahmen einer Veranstaltungsreihe um den Versöhnungsmarsch herum, die das Kriegsende und die Multikulturalität Brünns thematisierte. Und als sich 2016 aus dem „Jahr der Versöhnung“ das Festival „Meeting Brno“ entwickelt hatte, hat es Kateřina mehrere Jahre geleitet.
LE: Wie waren die Fortsetzungen bis 2015?
Die ersten acht Jahre – damals hieß die Veranstaltung noch „Gedenkmarsch“ – handelte es sich um ein sehr überschaubares Projekt. In 2008 und 2010 hatte ich ein paar Veranstaltungen drumherum organisiert, wie etwa eine Lesung mit der Schriftstellerin Radka Denemarková oder eine Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen. Aber es war eher improvisiert, sehr studentisch. Ein richtig großes Unterfangen, mit dem Marsch und dutzenden zusammenhängenden Veranstaltungen, ist es erst 2015 geworden. Im Jahr davor wurde ich zunächst vom Pfarrer Jan Hanák und von Tomáš Mozga vom Absolventenverein der Masaryk-Universität angesprochen, ob wir zum siebzigsten Jahrestag des Todesmarsches nicht etwas Größeres unternehmen wollten. Tomáš Mozga hatte dann die Idee, den Marsch umzudrehen, also symbolisch zurück nach Brünn zu marschieren. Dadurch hat die Initiative eine neue Ebene bekommen, es ging nun nicht mehr nur um Erinnerung und Gedenken, sondern auch um Versöhnung und Begegnung. Kurz danach hatten sich die Stadtregierung, allen voran Oberbürgermeister Petr Vokřál und sein Vize Matěj Hollan, hinter das Projekt gestellt und Finanzen sowie andere Kapazitäten beigesteuert. Daraufhin ist eine sehr bunte Gruppe von Menschen zusammengekommen, innerhalb der wir gemeinsam das „Jahr der Versöhnung“ entwickelt haben. Von Frühjahr bis Jahresende fanden in dem Rahmen etwa achtzig Einzelveranstaltungen statt, wobei die meisten von Partnern wie zum Beispiel dem Museum der Roma-Kultur [in Brünn, Anm. d. Red.] organisiert wurden. In seiner Breite und auch Tiefe war das ein einzigartiges Projekt, das durchaus hohe Wellen schlug. Vor allem der Versöhnungsmarsch und die vom Stadtrat beschlossene „Deklaration der Versöhnung und gemeinsamer Zukunft“ fanden große Beachtung in Tschechien und Deutschland – in Österreich leider weniger. Die Geste markierte einen Höhe- und gewissermaßen auch einen Schlusspunkt der Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf die Vertreibung, und zwar auf beiden Seiten. Man hatte sich tatsächlich versöhnt. Wir hatten viel Gegenwind, ja Feindseligkeit erwartet, aber das Gegenteil ist eingetreten. Es war, als wäre eine große Last von den Tschechen und von den Vertriebenen gefallen. Als hätte man endlich reinen Tisch gemacht. Das Einander-Näherkommen hatte ja schon mindestens seit der Wende stattgefunden. Der Versöhnungsmarsch mag diesen Prozess nur beschleunigt haben, auf jeden Fall stellte er eine große Geste dar, einen Abschluss, den die Entwicklung der Jahrzehnte davor offensichtlich verlangte.
LE: Wie ging es dann weiter?
Auf dem „Jahr der Versöhnung“ entstand wie gesagt „Meeting Brno“, ein zehntägiges Festival, das seit 2016 stattfindet. Bis heute sind unter seinen Veranstaltern mehrere Schlüsselfiguren des Jahres der Versöhnung, etwa Petr Kalousek oder Jiří Mottl. Ich selbst bin seit einigen Jahren nicht mehr dabei. Aber ich drücke den Kollegen die Daumen und bin sehr stolz darauf, wie sie das Festival weiterentwickeln. „Meeting Brno“ hat auch mehrere Veranstaltungsformate des Jahres der Versöhnung übernommen, nicht nur den Marsch. Jedes Festivaljahr hat ein Hauptthema oder Leitmotiv, sei es Migration, ein Rückblick auf 100 Jahre Republik, die Reflexion der drei Jahrzehnte seit der Wende oder unser gemeinsames Europa. Im Programm finden sich alle denkbaren Formate, von Konzerten und Theater über bildende Kunst bis zu Vorlesungen, Diskussionsveranstaltungen und Austausch aller Art.
LE: 2025 ist wahrscheinlich das letzte Jubiläumsjahr, das viele der ehemaligen Vertriebenen noch erleben werden. Wie wird der Versöhnungsmarsch in diesem Jahr verlaufen?
Grundsätzlich wie immer seit 2015: Wir gehen am Vormittag von Pohrlitz nach Alt-Brünn, wo wir gegen sechs Uhr abends ankommen. Wer nicht den ganzen Weg gehen will oder kann, dem stehen entlang der Strecke Sonderbusse zur Verfügung. Die pendeln in beiden Richtungen hin- und her. Dieses Jahr findet der Versöhnungsmarsch am 31. Mai statt, also genau am Jahrestag. Es kommen wieder zahlreiche Vertriebene sowie Brünner zusammen, und erwartet wird eine ganze Reihe an hochrangigen Persönlichkeiten. Es wird wieder ein unvergessliches Erlebnis werden, und ich möchte alle Leserinnen und Leser des LandesEcho ganz herzlich zum Versöhnungsmarsch, aber auch zu anderen Veranstaltungen im Rahmen von „Meeting Brno“ einladen.
Das Gespräch führte Mojmír Jeřábek
Mehr Informationen zum diesjährigen Brünner Versöhnungsmarsch hier: https://www.meetingbrno.cz/de/event/versoehnungsmarsch/
Dieser beitrag erschien zuerst in der landesecho-ausgabe 5/2025
Das neue LandesEcho 5/2025 ist da!
In unserer Mai-Ausgabe gehen wir der Frage nach, was Tschechien zu einem Land für Burgenliebhaber macht, berichten über das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und wir spüren der Rolle der Kirche in Mittelosteuropa nach. Daneben viele weitere Themen rund um Tschechien und die deutsche Minderheit.
Mehr…