Wie eine britische Enkelin das Leben eines antifaschistischen Sudetendeutschen erforschte und dabei tiefe Einblicke in ein verdrängtes Kapitel europäischer Geschichte gewann.
Sally Bywater, pensionierte Lehrerin aus London, wusste lange Zeit kaum etwas über ihren Großvater Alois Ullmann. Heute ist sie überzeugt: Seine Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten. Kurz vor dem 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa reiste sie mit ihrem Mann nach Tschechien, um die Spuren eines Mannes zu verfolgen, der als Sozialdemokrat, Antifaschist und NS-Verfolgter ein bemerkenswertes Kapitel sudetendeutscher Geschichte schrieb.
„Er war eine Schattenfigur“, sagt Sally Bywater beim Gespräch in Prag über ihren Großvater. Jahrzehntelang wusste sie nur wenig über ihn – nur, dass er aus dem Sudetenland stammte und während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war. Als Sally Bywater, geboren 1953, im Großbritannien der Nachkriegszeit aufwuchs, wurde in der Familie kaum über die sudetendeutsche Herkunft gesprochen. Sallys Vater Lou, Alois Ullmanns jüngster Sohn, verließ die Familie, als sie erst acht Jahre alt war. Erst viel später begann sie, sich intensiver mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen.

Den europäischen Wurzeln auf der Spur
Den Anstoß gaben zwei Ereignisse: Zum einen der Brexit, der in ihrer Familie als tiefer Einschnitt erlebt wurde. „Meine Familie war am Boden zerstört. Sie sagten: Du musst etwas tun. Und ich dachte: Wenigstens kann ich beginnen, meine europäische Geschichte zu verstehen.“ Den zweiten Anstoß gab ein DNA-Test, der ihre Herkunft zu 42 Prozent in Mittelengland und zu 24 Prozent in der Gegend um Karlsbad (Karlovy Vary) verortet. „Ich wollte mehr über diese 24 Prozent in meiner DNA herausfinden, denn ich bin Britin, aber auch Europäerin“, sagt Sally Bywater.
Ihre Recherche führte sie schließlich zur Seliger-Gemeinde – der Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten – und zum Historiker Thomas Oellermann. Mit dessen Unterstützung und gemeinsam mit ihrem Halbbruder Chris Ullmann und weiteren Nachfahren begann sie, das Leben ihres Großvaters Stück für Stück zu rekonstruieren. Eines Mannes, der zeitlebens für seine Überzeugungen kämpfte: zuerst für die Demokratie in der ersten Tschechoslowakischen Republik, dann gegen den Nationalsozialismus – und nach dem Krieg für die Integration sudetendeutscher Sozialdemokraten in Westdeutschland. Heute ist der Name Alois Ullmann selbst in Fachkreisen kaum noch bekannt. Und doch steht seine Biografie beispielhaft für die Brüche, Katastrophen und Hoffnungen Mitteleuropas im 20. Jahrhundert.
Alois Ullmann: Vom Glasbläser zum Gewerkschafter
Geboren 1888 im böhmischen Tüppelsgrün (Děpoltovice) bei Karlsbad (Karlovy Vary), arbeitete Alois Ullmann schon als Kind in Fabriken, um seine Familie zu unterstützen. Nach einer Ausbildung zum Glasbläser wurde er 1912 Meister seines Fachs. Früh politisiert, trat er 1911 der österreichischen Sozialdemokratie bei und schloss sich nach der Gründung der Tschechoslowakei 1919 der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (DSAP) an. Im Ersten Weltkrieg diente er in der k.u.k. Armee. Als überzeugter Demokrat engagierte er sich nicht nur in der Parteipolitik, sondern insbesondere im Arbeiter-Turn- und -Sportverband (ATUS). Für ihn war Sport ein Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe.
„Er war zwar kein Abgeordneter oder Mitglied des tschechoslowakischen Senats, aber er war eine der führenden Personen, denn er war, sagen wir mal, die wirklich handelnde Person in der Arbeitersportbewegung“, weiß Historiker Thomas Oellermann, der sich mit der deutschen Sozialdemokratie in der ersten Tschechoslowakischen Republik beschäftigt.
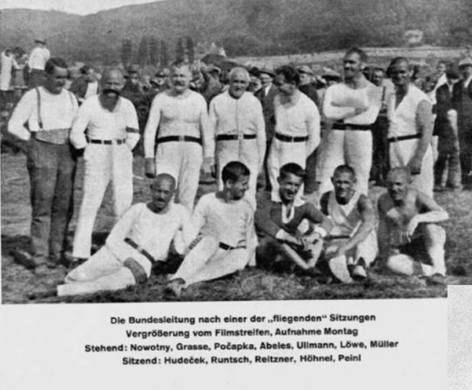
Flucht und Rückkehr
Als Leiter der Republikanischen Wehr warnte Ullmann früh vor dem aufkommenden Nationalsozialismus. Nach dem Münchner Abkommen im Herbst 1938 und der Annexion des Sudetenlandes durch das Dritte Reich geriet er ins Visier des NS-Regimes. Im Oktober 1938 floh er nach Großbritannien, seine Frau Emma folgte mit dem jüngsten Sohn Alois „Lou“ im Dezember.
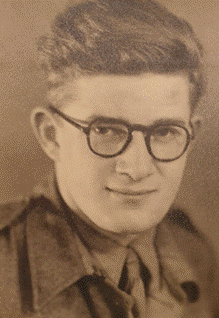
Doch 1939 kehrte Ullmann zurück nach Prag. Über die Gründe kann Sally Bywater nur mutmaßen. „Er wollte sie – so gut es ging – in Sicherheit bringen. Aber er hatte noch drei erwachsene Kinder in Prag und ich denke, dass er Teil des Widerstands sein wollte. Und es gab da wohl noch eine andere Frau.“
Die Entscheidung hatte schwerwiegende Folgen: Nach der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ durch die Nationalsozialisten wurde er auf der Straße von der Gestapo aufgegriffen. Mehrere Monate lang wurde er verhört und schließlich ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Dort blieb er bis zur Befreiung 1945. Nach und nach erfuhr Sally Bywater auch mehr über die Zeit ihres Großvaters im Lager: Dort soll er als Krankenpfleger tätig gewesen sein und sich – was sie erst kürzlich erfuhr – besonders um kranke Gefangene aus der Tschechoslowakei gekümmert haben, etwa, indem er deren Aufenthalt auf der Krankenstation heimlich verlängerte. Auch in Dachau sei er also anscheinend ein guter Mensch gewesen, meint Sally Bywater, die keine lebendigen Erinnerungen an ihren Großvater hat.
Die „Aktion Ullmann“ & Neuanfang in Bayern
Nach der Befreiung 1945 kehrte Ullmann zurück in die Heimat. Zunächst nach Prag, dann nach Aussig (Ústí nad Labem), wo er im Sommer 1945 Zeuge des „Aussiger Massakers“ wurde, bei dem deutsche Zivilisten Opfer von Vergeltungsaktionen wurden. Dennoch versuchte er, in seiner Heimat einen politischen Neuanfang zu wagen – aber vergeblich. Die Vertreibung der Sudetendeutschen hatte bereits begonnen.
Noch bevor Ullmann 1946 mit seiner Familie nach Bayern ging, rief er die nach ihm benannte „Aktion Ullmann“ ins Leben, durch die rund 73.000 sudetendeutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine kontrollierte und vergleichsweise geordnete Ausreise nach Deutschland ermöglichte wurde – im Gegensatz zu den teils chaotischen und brutalen Vertreibungen vieler anderer Deutscher. Zudem war er 1951 Mitbegründer der Seliger-Gemeinde, der Nachfolgeorganisation der DSAP. Daneben wirkte er als Geschäftsführer des Verlags „Die Brücke“, welche die erste sudetendeutsche Zeitung in Westdeutschland herausbrachte. 1957 starb Ullmann in München an Krebs, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit.

Erinnern zwischen England und Böhmen
All das hat Sally Bywater in den vergangenen Jahren mühselig rekonstruiert. Ihre Reise führte sie bis nach Dachau, wo ihr Großvater nach dem Krieg in den ehemaligen Offiziersquartieren lebte, sowie nach Prag, wo sie in Archiven weitere Mosaiksteine seiner Geschichte fand. Ihre Nachforschungen offenbarten nicht nur historische Fakten, sondern auch offene Wunden: antideutsche Anfeindungen am Haus der Großmutter in England, das Schweigen des Vaters, das schwierige Verhältnis zur Vergangenheit. Sally begegnet diesen Brüchen mit Empathie und Hartnäckigkeit.
Für die heute 71-Jährige ist es auch ein zentrales Anliegen, das Erbe ihres Großvaters an die nächsten Generationen weiterzugeben. Ihre beiden Töchter interessieren sich ebenso für die Familiengeschichte wie ihre Enkel – auch wenn diese noch zu jung sind, um die Zusammenhänge ganz zu erfassen. Sie wolle, sagt Bywater, dass ihre Kinder und Enkel wissen, woher sie kommen – und dass die Geschichte dokumentiert wird. Die Recherche, das Erzählen, das Teilen – all das versteht sie inzwischen nicht nur als persönliche Spurensuche, sondern auch als Beitrag zu einer grenzüberschreitenden Erinnerungskultur. Was früher in ihrer Familie kaum thematisiert wurde, wird heute aufbewahrt, weitergegeben – und mit Stolz erzählt. „Ich denke, es ist wichtig, vor allem wenn man bedenkt, was im Moment in der britischen Politik passiert, dass wir uns daran erinnern, dass wir Teil Europas sind, nicht nur eine isolierte kleine Insel“, meint Sally Bywater schließlich.
Für sie ist die Spurensuche längst nicht abgeschlossen, immer wieder kommen neue Details ans Licht. Dieses Jahr traf sie in Aussig zum ersten Mal Nachkommen ihres Großvaters, die bis heute in Tschechien leben. Dort erfuhr sie von bisher unbekannten Briefen, die ihre Großmutter Emma in die Tschechoslowakei geschickt hatte.
Mit neuen Mosaiksteinen der Familiengeschichte im Gepäck treten Sally und Edward Bywater die Heimreise nach England an – mit dem Zug durch den Eurotunnel.




